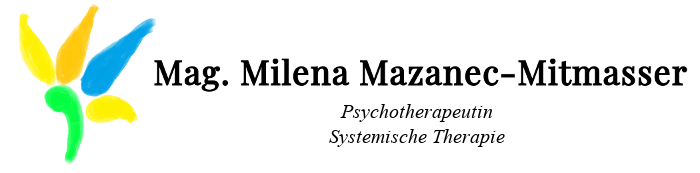Cinematherapy – oder auch Cinetherapie oder Filmtherapie – sowie Poesie- und Bibliotherapie sind Begriffe für Therapieformen, in welchen Werke aus Literatur und Film bzw. auch das eigene Verfassen von Texten, die Sprache bzw. das Schreiben therapeutisch eingesetzt werden.
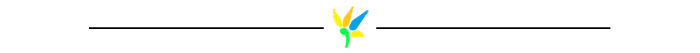
Die Filmtherapie nutzt bestimmte Filme oder Filmsequenzen, um den Klient*innen z.B. ein „Probe-Fühlen“ zu ermöglichen, sie emotional zu berühren, sie Krisen und deren Lösungen beobachten zu lassen, ohne dass sie selbst aktiv eingreifen müssen.
„Die Auseinandersetzung mit dem Medium Film war von Anfang an eine wissenschaftlich interdisziplinäre. Zunehmend kommen neben psychoanalytischen Aspekten auch jene aus dem Bereich der Emotionsforschung der Cognitive Film Theory hinzu. Warum machen Spielfilme etwas mit uns? Ganz vereinfacht und global gesagt: Sie berühren uns. Etwas in uns bewegt sich. Der Zuseher verwandelt die dargestellte Welt so, dass sie zu seinem eigenen inneren Zustand werden kann. Er leistet quasi eine Übersetzungsarbeit.“[1]
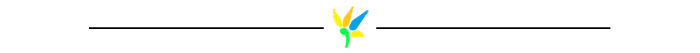
Filmfiguren sowie literarische Figuren können eine Entwicklung durchlaufen und damit zur Selbsterfahrung und Selbstreflexion anregen. So schreibt etwa der psychologische Psychotherapeut Niklas Gebele mit Bezug auf den Einsatz von Filmen und Serien in der Psychotherapie: „Geschichten waren schon immer mehr als nur Unterhaltung. Sie vermitteln implizites Wissen über zentrale menschliche Gefühle und Motive sowie komplexe soziale Interaktionsprozesse. Sie bieten Möglichkeiten zum Modellernen und probeweisen Durchspielen von sozialer Interaktion, Problemlösung, Empathie und Emotionsmanagement. Und wie alle Geschichten stellen auch und vor allem die psychologisch fundierten, menschlich diversen popkulturellen Stoffe der Gegenwart einen niederschwelligen und zugleich sehr fruchtbaren Zugang zu Selbstexploration und Selbsterkenntnis dar, der für die psychotherapeutische Arbeit von großem Nutzen sein kann.“[2]
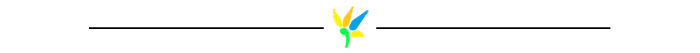
Beim Betrachten von Filmen werden wir auf vielen Ebenen mit Informationen „gefüttert“ – visuell und auditiv, wir sehen, hören die Handlung, beobachten die Handlungen und Emotionen der Darsteller*innen. Entwicklungsprozesse der Filmfiguren lassen sich im therapeutischen Prozess hinterfragen, als Beispiele verwenden; Analogien und Kontraste können entdeckt werden, Perspektivwechsel – z.B. beim Versuch, sich in die Protagonist*innen hineinzuversetzen – können Erkenntnisse bringen, mittels Film genauso wie mittels Literatur oder Drama.
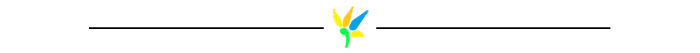
In ihrem Buch „Positive psychology at the movies 2“ schreiben Ryan Niemiec und Danny Wedding, dass es noch relativ wenige Studien zu Filmtherapie, aber doch zahlreiche Fallberichte und -beispiele gibt, die eine hilfreiche Wirkung von Filmen verdeutlichen: „There are a significant number of anecdotal and case report data dcumenting its benefits in building hope, providing role models, identifying and reinforcing internal strengths, facilitating communication, and helping clients prioritize values.“[3] Filmtherapie wird sowohl in freien Praxen als auch teilweise in stationären Kontexten eingesetzt, so gab es z.B. am Wiener Anton Proksch – Institut ein Cinematherapie-Programm. Bei den Ergebnissen des Projektes lässt sich im Abstract nachlesen: „Es ließ sich beobachten, dass die gezeigten Filme eine emotionale Werterschließung leisten und generell einen sehr starken Einfluss auf die Affektlage ausüben. Nach dem Film bzw. der Filmnachbesprechung herrschte bei der Mehrheit der Teilnehmer eine positive Stimmung und euthyme Gemütsverfassung. Vor allem in der Nachbesprechung hat sich gezeigt, dass mittels gezielter Figuren-, Beziehungs-, Situations- und Motivanalyse viele fruchtbringende Diskussionen zustande kamen. Filme, die sich explizit auch des Mediums Musik bedienen zeigten in der Nachbesprechung, wenn einzelne Musiksequenzen erneut gezeigt und besprochen wurden, die extreme Berührbarkeit unserer Patienten durch dieses Medium.“ [4]
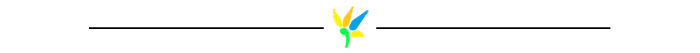
Therapeutisch lässt sich die Reise eines Helden/einer Heldin aus Film, Literatur oder Drama z.B. auch für die eigene Biographiearbeit verwenden, es können Gleichklänge und Gegensätze herausgearbeitet werden, alternative Erzählungen, wichtige Momente im Leben der Figuren sowie in der eigenen Lebensgeschichte, … – die Möglichkeiten sind vielfältig.
In „Positive psychology at the movies“ wird auch eine Studie erwähnt, in welcher der positive Effekt von Filmtherapie auf den Selbstwert von jungen Menschen gezeigt werden konnte. So half Cinetherapie den Kindern dabei, Emotionen zu erkennen und auszudrücken und ihre Bewältigungsstrategien zu verbessern. (Vgl. Niemiec, Wedding, S. 24)
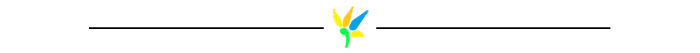
So bietet der Einsatz von künstlerischen Medien wie Film, Theater, Literatur und Musik zahlreiche Möglichkeiten in der Therapie. Schlüsselelemente dabei sind vermutlich Empathie und Emotionen. Kunst scheint uns auf verschiedenste Arten zu berühren. Niemiec und Wedding beschreiben diesen empathischen Prozess bei der Filmrezeption: „Film hence offers an opportunitiy for empathy with others, enables a reflection on these emotions and their meanings, and facilitates emotions such as elevation and admiration (…)“ [5]
Bei Empathie und Emotionen öffnen sich weite Forschungsfelder, insbesondere im Bereich der Film- bzw. Medien- und Rezeptionsforschung ist hier nicht nur bereits viel untersucht und erforscht worden, sondern sind weiterhin viele Fragen offen und verschiedene Ansätze nähern sich der Thematik aus unterschiedlichen Richtungen an – aber dazu mehr in einem anderen Blogbeitrag. ☺️
[1] Brigitte Fellinger, Spielfilme in der Psychotherapie, München: Reinhard 2018, S.43f
[2] Niklas Gebele, Märchen, Mythen, Netflix. Zum Arbeiten mit populären Narrativen in der Psychotherapie, Gießen: Psychosozial-Verlag 2021, S. 18f
[3] Ryan M.Niemiec, Danny Wedding, Positive psychology at the movies, Göttingen: Hofgrefe 2014, S. 23
[4] Https://www.thieme-connect.com/products/journals/abstract/10.1055/s-0031-1284514?lang=en; letzter Zugriff am 3.8.2025
[5] Ryan M.Niemiec, Danny Wedding, Positive psychology at the movies, Göttingen: Hofgrefe 2014, S. 16